
Kleine Schwester Annemarie erzählt von ihren Erfahrungen in der Begleitung von Kranken:
“Seit jeher war ich berührt von den Begegnungen Jesu mit den Kranken, die einen so zentralen Platz in den Evangelien einnehmen: mit Blinden, Gelähmten, am Eingang des Tempels sich selbst Überlassenen, Aussätzigen, die von der Gesellschaft ausgestoßen worden waren. Im Laufe meines Lebens kam ich auch oft mit Krankheit in Berührung, und das hat mich sicher, ohne dass ich mir dessen bewusst war, sensibel gemacht für das Leiden: körperliches Leiden, aber auch psychisches Leiden, das niemandem im Laufe seines Lebens erspart bleibt.
“Ich war krank und ihr habt mich besucht…”
Im Evangelium hat mich das 25. Kapitel des Matthäusevangeliums immer berührt: durch seine Schlichtheit, aber auch seine Wahrheit: “Ich war krank, und ihr habt mich besucht.” “Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.” So war es fast natürlich, dass ich als Kleine Schwester oft im Kontakt war mit Kranken – die Kranken waren für Charles de Foucauld ja ein konkreter Ausdruck der “Geringsten”, in denen Jesus selbst gegenwärtig ist. “All das Gute, das ihr den Menschen tut: ihrer Seele, ihrem Leib, ihrem Herzen, das tut ihr Jesus selbst, von dem sie Glieder sind.” (Charles de Foucauld)
Mit einem Besen in der Hand am Krankenbett
Diese Nähe zu den Kranken habe ich mehrere Jahre lang in einer Einrichtung für Palliativmedizin gelebt, wo ich als Reinigungskraft arbeitete. Diese Form, mich der “Welt” der Kranken zu nähern, war für mich sehr kostbar, denn so sehr ich auch wünschte, mich auf die Begegnung mit Menschen, die leiden, einzulassen, so empfand ich zugleich auch eine gewisse Scheu, manchmal fast Angst davor, mit dem Leiden konfrontiert zu sein – mit leeren Händen, meiner eigenen Ohnmacht ausgesetzt wie auch dem Nicht-Begreifbaren. Und so muss ich zugeben, dass mir mein Status als Reinigungskraft, mit einem Besen in der Hand, oft sehr hilfreich war, um in Kontakt zu kommen mit den Kranken. Es ist bestärkend und tröstend, etwas zu tun zu haben, etwas geben zu können, wenn man mit einem Menschen konfrontiert wird, der leidet; das gibt einem gewissermaßen das Recht, in seine Nähe zu kommen und in seine Privatsphäre einzudringen, wenn man in sein Zimmer kommt, um sauber zu machen. Wenn man um sein Bett herum beschäftigt ist, wechselt man ein paar Worte über die Dinge des Alltags, ein paar Blicke… und manchmal ist das alles. Und wer würde sich darüber beschweren – die Arbeit ist ja gemacht.
Nicht mehr nur “der/die Kranke”…

Ja, manchmal ist das alles, aber manchmal eröffnet ein Wort oder eine ganz alltägliche Geste auch noch mal etwas ganz Neues. “Soll ich Ihnen noch etwas Wasser einschenken?” „Lesen Sie gerne?“ oder auch „Sind das die Fotos ihrer Enkel?“ In wenigen Augenblicken kann sich die Situation total verändern: da findet sich nicht mehr die Reinigungskraft dem Kranken gegenüber, sondern da begegnen sich zwei Menschen, verbunden in ihrem gemeinsamen Menschsein. Das ist so, als ob der Mensch, reduziert auf sein Kranksein und darin eingeschlossen, wieder in die „Welt der Lebenden“ zurückkehrt, in diese Welt, von der er sich ausgeschlossen fühlt, die ganz ohne ihn funktioniert oder die ihn bekümmert:
„Ich mache euch so viele Sorgen… Was soll ich denn da noch? “ Das einfache, aufmerksame Dasein kann einer Person das Gefühl zurückgeben, das sie um ihrer selbst willen existiert, dass sie nicht nur ein „Lungenkrebs“ ist oder die „Frau aus Zimmer 23“. Sie ist ein Mensch mit einer Geschichte, mit Schönem und Schwierigen, mit Licht und Schatten. Und es ist ihr überlassen, was sie davon erzählen oder wo sie lieber schweigend ihr „Geheimnis“ wahren möchte. Aber allein in ein paar stammelnden Worten sagen können, dass ihr Leben mehr ist als die gegenwärtige Situation, als die alles in Beschlag nehmende Krankheit; ins Wort bringen können, dass dieser kranke Leib, der sein Leiden fast herausschreit, der manchmal von Tag zu Tag schwächer wird, ein Mann, eine Frau voller Tatkraft war, die Verantwortung trug, ihren Platz in der Gesellschaft hatte.
Nicht mehr mit sich alleine sein… Wie oft hat man mir gesagt: „Lassen Sie ihren Besen und setzen Sie sich ein wenig; das Putzen kann noch warten…“ Denn als Reinigungskraft hat man ja weder die Macht des Pflegepersonals, noch ist man gefühlsmäßig so eingebunden wie Familie und Freunde; man ist ein bisschen neutral, nicht zuzuordnen – und wie viel hat man mir gerade dadurch anvertraut. Ich erinnere mich noch an diesen Mann, der seine Lebensgeschichte erzählte, mit dem, was ihm gelungen war, und mit den Misserfolgen, und was er im Blick auf all das nun empfand. Es ist wie ein Bedürfnis, alles noch mal anzuschauen, Bilanz zu ziehen… ein Sandkorn, eine kleine Spur in der riesigen Welt. Ja, ein Menschenleben, das ist keine Kleinigkeit…
Im Dienst als beauftragte Seelsorgerin
Als ich in Rente ging, hatte ich ganz von selbst den Wunsch, weiterhin im Dienst der Kranken zu sein, wenn auch in neuer Weise: in der Seelsorge in unserem städtischen Krankenhaus: ein Krankenhaus mit 700 Betten in den verschiedenen Abteilungen. Wir sind zu sechst, um regelmäßig ein oder zwei Abteilungen des Krankenhauses zu besuchen. Die Arbeit im Team ist für mich wesentlich. Zum einen erinnert sie mich daran, dass dieser Dienst eine Aufgabe ist, die einem übertragen wird – man gibt sie sich nicht selbst, sondern wird dazu beauftragt. Und so ist man nicht allein. Die Kirche beauftragt uns im Namen Christi… oder vielmehr die kirchliche Gemeinde vor Ort bittet uns darum, nicht jene Schwestern und Brüder zu vergessen, die leiden, alleine sind, wer auch immer sie sein mögen – sie sind unsere Geschwister in der einen Menschheitsfamilie. In der Tat sind die wenigsten Menschen, die wir besuchen, Christen, oder sie haben nur noch sehr entfernten Bezug zum christlichen Glauben. Aber darauf kommt es nicht an. Es geht zunächst um die Begegnung mit einem Menschen, unabhängig von seiner religiösen Bindung. Und so versuche ich auch in der Abteilung „Innere Medizin“, die ich regelmäßig besuche, durch alle Zimmer zu gehen, ohne Vorurteile. Ich bemühe mich, diskret zu sein, auch wenn mich mein Namensschild als Mitglied der katholischen Krankenhausseelsorge ausweist. In der Regel werde ich freundlich aufgenommen. Und es geht ja in erster Linie darum, zu bezeugen, wie sehr sich Gott für jeden Menschen interessiert, etwas von seiner Güte, Barmherzigkeit, seinem Mitgefühl aufscheinen zu lassen. Gott ist uns so nahe, wer auch immer wir sind, wie auch immer unser Leben aussieht.
Nicht belehrend, sondern zuhörend
Ich bin nicht dazu da, um dem anderen eine Botschaft oder Lehre aufzudrängen und dabei seine Situation der Abhängigkeit und Verwundbarkeit auszunutzen. Es geht darum, den anderen dabei zu unterstützen, zu sich selbst zu finden, zu einer inneren Stimmigkeit. Das wichtigste ist dabei das Zuhören, damit der Kranke sich ernstgenommen erfährt mit allem, was sein Leben ausmacht. Auch als Kranker liegt sein Leben in seinen Händen und es liegt an ihm, welchen Sinn, welche Richtung er seinem Leben geben möchte. Dennoch kann das ein oder andere Wort verletzen, so behutsam man es auch zu sagen versucht. Es mag als Angriff empfunden werden: als Angriff dessen, dem es gut geht (so wird man als Besucher ja oft gesehen) auf den, der schmerzlich seine Ohnmacht und seine Abhängigkeit erlebt. Es geht nicht darum, die Zeit mit nichtssagenden Worten zu füllen, sondern die Worte sollen zu einem Klima des Vertrauens beitragen, der gegenseitigen Aufmerksamkeit, wo das Wesentliche zur Sprache kommen kann. Und das haben wir nicht in der Hand, das bleibt immer auch unverfügbar. Aber dort, wo wir offen und aufmerksam füreinander sind, wie viel kommt da von den Erfolgen und Misserfolgen des Lebens zur Sprache, vom Leiden, vom Tod… Wie viel Vertrauliches kommt zur Sprache!
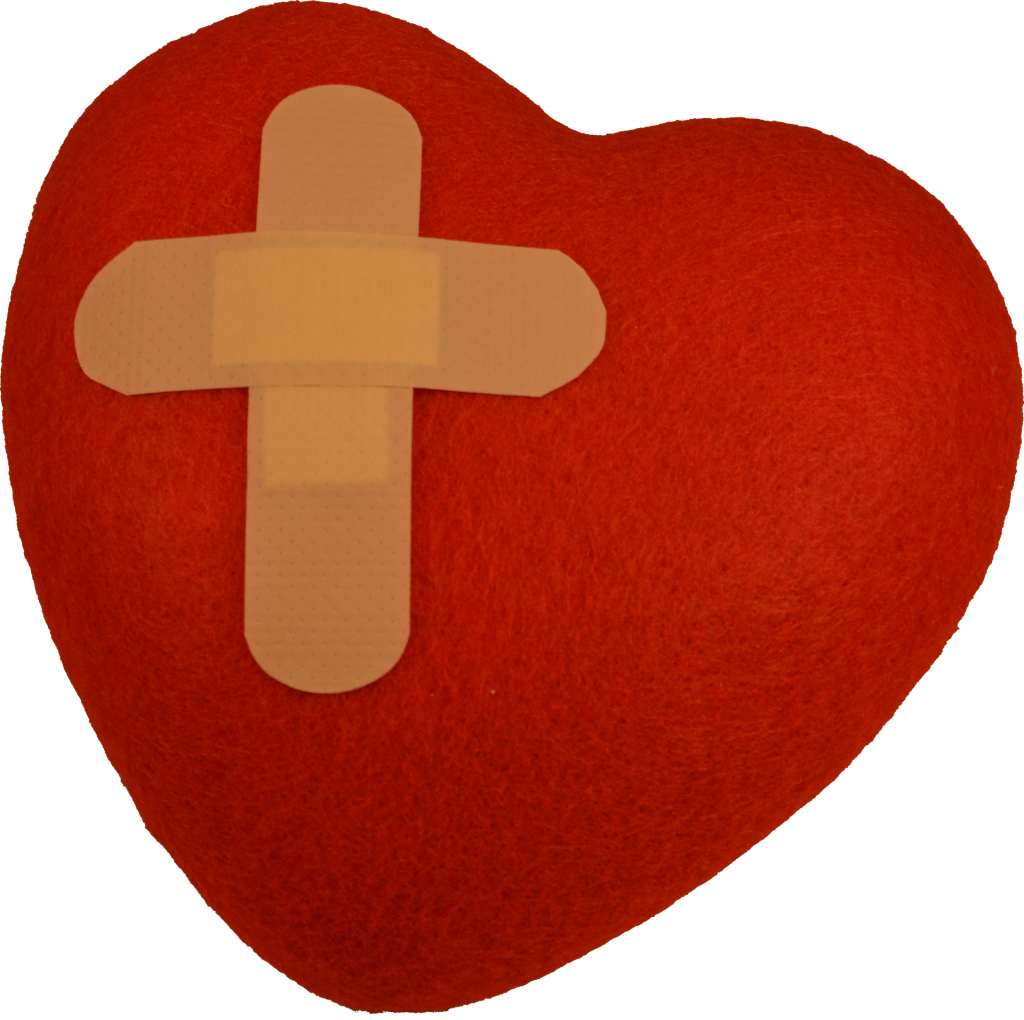
Eine Tür in eine andere Zukunft
Ich erinnere mich noch an den Mann, der mich bei meinem ersten Besuch sehr kühl empfangen hatte. Trotz seines langen Aufenthaltes im Krankenhaus hatte ich aus Respekt gezögert, ihn erneut zu besuchen. Der Zufall wollte es, dass er in ein anderes Zimmer verlegt worden war. Und so traf ich ihn eines Tages wieder, als ich seinen Zimmernachbar besuchte. Als ich am Gehen war, wendete er sich an mich: „Und ich? Sie gehen einfach wieder?“ Ein wichtiger Anruf, der eine sehr lebendige und lebendspendende Begegnung möglich gemacht hat. Gott war darin nie explizit erwähnt worden, und doch bin ich sicher, dass er darin gegenwärtig war. So wie er unter den Emmausjüngern gegenwärtig war, als diese über ihr Leben sprachen. Das Leben dieses Mannes ging weiter, als er aus dem Krankenhaus entlassen worden war; und ich hoffe darauf, dass dieser Krankenhausaufenthalt nicht einfach nur eine „Unterbrechung“ war, sondern eine Türe in eine andere Zukunft; dass weitere Begegnungen ihm ermöglicht haben, die Erfahrung der Emmausjünger zu machen bis hin zum Verstehen der Schrift und dem Brechen des Brotes.
Natürlich gibt es in all diesen Begegnungen auch Menschen, die den christlichen Glauben teilen. Für viele ist es der Glaube ihrer Kindheit, der weit zurückliegt, der manchmal auch verknüpft ist mit verletzenden Erfahrungen mit der Kirche: nach einer Scheidung oder einem Trauerfall. Wie viele Fragen und Schmerzen liegen da oft im Leben eines Menschen verborgen. Und auf einmal, auf einem Krankenbett, wo die Zeit still zu stehen scheint, können einen Menschen viele Fragen umtreiben… Und wie gut kann es da tun, sie ins Gespräch zu bringen, aussprechen zu können, wo man steht mit Gott, mit den anderen, mit sich selbst. Das ist oft Gelegenheit, das Antlitz Gottes, wie es uns Jesus offenbart hat, wiederzuentdecken, gemeinsam zu beten – mit einem Psalm oder einem Evangelientext. „Du bist ein barmherziger und gnädiger Gott, du bist langmütig, reich an Huld und Treue. Wende dich mir zu und sei mir gnädig.“ (Psalm 86) „In der Nacht, wo ich zu dir rufe, möge mein Gebet zu dir dringen.“
Jede Begegnung ist überraschendes Geschenk
Jede Begegnung bleibt für mich eine Gabe Gottes, ein oft überraschendes Geschenk! Und im Herz all dieser Begegnungen das tiefe und verborgene Geheimnis jedes Menschen. Und dieses Geheimnis begleitet mich, bestärkt mich im Glauben, in meinem Beten. Wenn ich aus dem Krankenhaus fortgehe, bin ich froh über den Fußweg nach Hause, über die Stille des Weges. Es ist wie ein „Zwischenraum“, den ich brauche, damit Gottes Blick auf die Zeit der Besuche fallen kann, um ihm alles anvertrauen zu können, denn er allein kennt die Herzen der Menschen, er allein weiß, was jeder Mensch braucht, und er allein kann es im Tiefsten schenken.
Wenn ich nochmal auf mein Verhalten schaue – und in diesem Punkt muss man sehr ehrlich und bescheiden bleiben, denn wie viele ungeschickte Worte oder mangelndes Feingefühl können verletzen, ohne es zu wollen – so überlasse ich Gott die Früchte all dieser Begegnungen. Ich kann ihm lediglich alles hinhalten – mit Dankbarkeit, oder Fürbitten.”
Kleine Schwester Annemarie
